Wer nicht digitalisiert, wird liquidiert
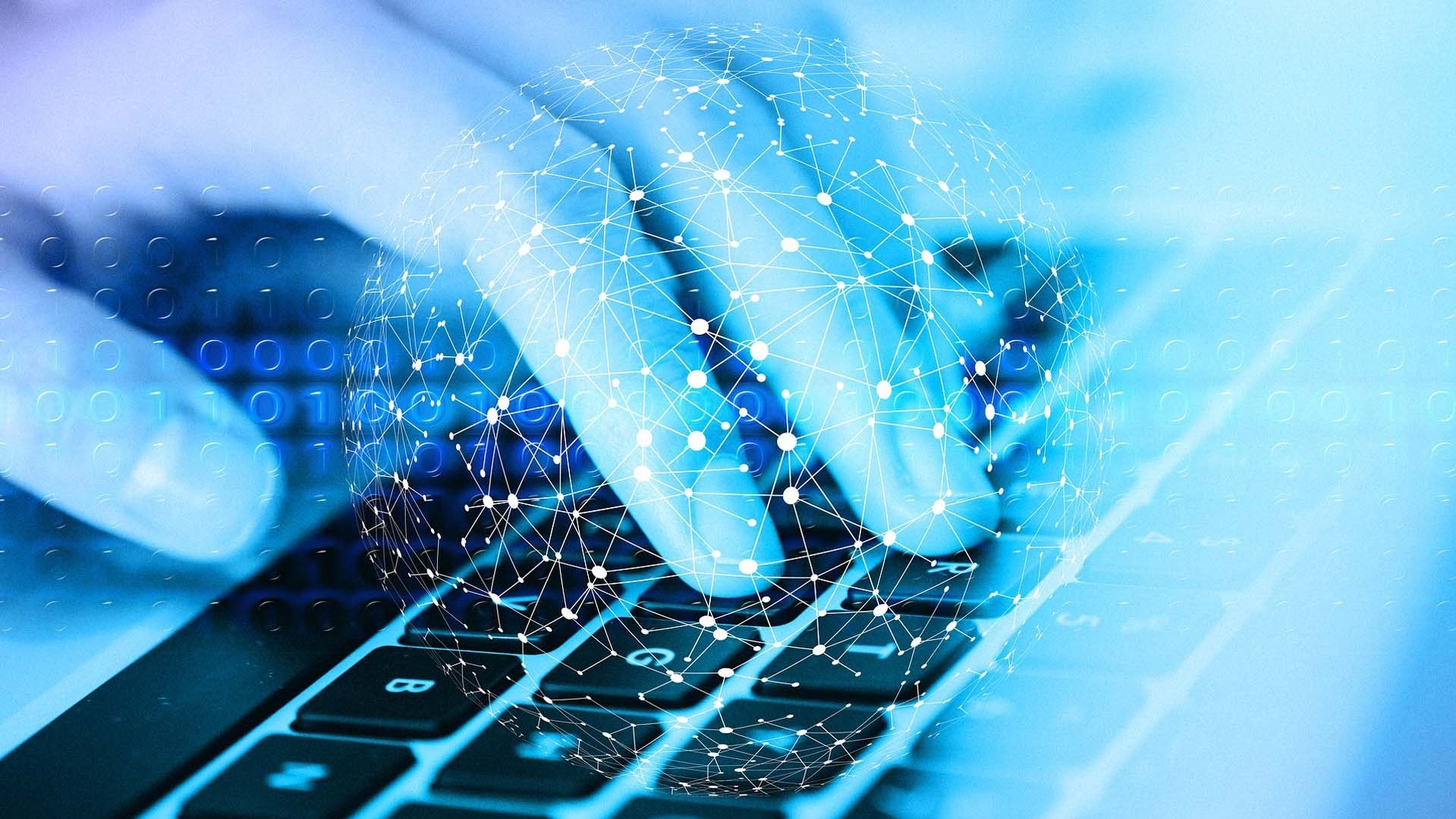
Innovationen sind gerade im digitalen Zeitalter überlebensnotwendig für Unternehmen. Eine Studienarbeit in Zusammenarbeit mit digital-liechtenstein.li zeigt auf, dass Unternehmen den digitalen Wandel aktiv vorantreiben müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die digitale Transformation hat erhebliche Auswirkungen für die Wirtschaft: Einerseits können Unternehmen innovative Geschäftsmodelle entwickeln, neue Berufsbilder schaffen, Prozesse vereinfachen und einen Mehrwert für ihre Kunden bieten. Andererseits birgt der technologische Wandel die Gefahr, dass traditionelle Branchen strukturelle Probleme bekommen, ein Teil der Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und vernetzte IT-Systeme problemanfälliger werden. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass die meisten KMU sich darüber bewusst sind, dass sie sich mit der digitalen Transformation auseinander setzen müssen. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, ob Unternehmen den Wandel mit einer klaren Vision angehen oder fallbezogen reagieren sollen.
Mehr als ein IT-Thema
Florian Schmitt aus Gams hat für seine Masterarbeit mehrere Unternehmer und Entscheidungsträger aus Liechtenstein und der Schweiz befragt und überraschende Erkenntnisse zum Umgang mit dem digitalen Wandel zu Tage gefördert. «Die meisten KMU wissen, dass die digitale Transformation kein IT-Thema ist, sondern alle Bereiche im Unternehmen betrifft», sagt Schmitt. Trotzdem haben nur die wenigsten Firmen eine speziell entwickelte Strategie, wie sie mit der fortschreitenden Digitalisierung umgehen. Vielmehr verfolgen sie einen pragmatischen und opportunistischen Ansatz, indem sie die aktuellen Entwicklungen verfolgen und situativ und auf einzelne Projekte bezogen reagieren.
Innovation und Digitalisierung gehören zusammen
Für Lorenz Risch ist die Digitalisierung ein fixer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Risch ist Chief Medical Officer der Dr. Risch-Gruppe mit 16 Laborstandorten in der Schweiz und in Liechtenstein. Besonders in der aktuellen Situation seien Digitalisierung und Innovation von enormer Bedeutung für jedes Unternehmen, welches sich weiterentwickeln wolle. «Es reicht heute nicht mehr, dass ein Unternehmen attraktive Produkte und Dienstleistungen anbietet, sondern es geht um ein ganzheitliches Kundenerlebnis. Dabei spielt Digitalisierung eine entscheidende Rolle.» Er sieht die Herausforderung darin, das richtige Mass an Digitalisierung zu finden. «Ich glaube, dass man am Anfang mit relativ wenig Aufwand viel erreichen kann. Irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo die Massnahmen kostspielig werden und nur noch einen geringen Effekt zeigen.»
Keine Digitalisierung auf Knopfdruck
Eine übertriebene Erwartungshaltung kann dabei die digitale Transformation nachhaltig belasten: «Man kann nicht einfach auf einen Knopf drücken, um den digitalen Wandel zu starten. Digitalisierung hängt sehr stark mit den Abläufen, der Organisation und den Prozessen eines Unternehmens zusammen. Deshalb müssen alle Massnahmen am Schluss den eigentlichen Businesszweck unterstützen», sagt Christian Wolf, Partner der Beratungsfirma BDO (Liechtenstein). Er ist überzeugt davon, dass der digitale Wandel aktiv von der Spitze eines Unternehmens vorangetrieben werden und alle Mitarbeitenden in den Prozess eingebunden werden müssen: «Wir dürfen nicht vergessen, dass der grösste Bremser am Schluss der Mensch sein kann», sagt Wolf.
Agile Ansätze im Vorteil
Christoph Wille sieht im Umgang mit der Digitalisierung vor allem Startups im Vorteil: «Junge Menschen denken weniger in Schachteln als langjährige Fachkräfte. Sie kommen beispielsweise frisch von der Universität und bringen neues Wissen und neue Ideen aus ihrem Studium mit», sagt der Gründer und CEO von Innoforce. Gerade Startups hätten dadurch einen Vorteil gegenüber Grossfirmen, indem sie innovativ bleiben, ohne dafür eine eigene Innovationsabteilung aufzubauen. Dank digitaler Tools könnten Prozesse und Abläufe massiv vereinfacht und beschleunigt werden: «Früher benötigten wir für eine Offerte einen halben Tag Aufwand. Jetzt schaffen wirs in 15 Minuten.»
Reifegrad messen
Florian Schmitt kommt in seiner Arbeit zum Schluss, dass in den Chefetagen das Verständnis für den digitalen Wandel durchaus angekommen ist und Handlungsbedarf gesehen wird. «Entscheider in Unternehmen stehen nun vor der Herausforderung, zwar den Zusammenhang zu sehen, die Mechanismen dahinter aber nur schwer einschätzen zu können.» So zeigen aktuelle Erhebungen, dass zwar eine Korrelation zwischen Digitalisierung und Innovation besteht, allerdings muss ein erhöhter Grad an digitaler Transformation nicht zwangsläufig zu einer höheren Innovationsleistung führen. Trotzdem rät Schmitt den Unternehmen dazu, sich intensiver mit der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Er empfiehlt dafür sogenannte Reifegradmodelle. Diese erlauben Unternehmen, mittels vorgefertigter Modelle und Fragebögen einen Selbstcheck für die Lagebestimmung durchzuführen. Das Ergebnis zeigt einen Vergleich mit anderen Unternehmen aus derselben Branche und gibt Aufschluss darüber, wie gross der Handlungsbedarf ist.
Ein solches Tool zur Standortbestimmung hat die Organisation SwissICT entwickelt. Geschäftsführer Christian Hunziker sagt, der Test zeige auf, wo man im Vergleich zur Konkurrenz stehe. So könnten Unternehmen erkennen, wo sie Aufholbedarf haben und gezielt an ihren Schwächen arbeiten. Die Notwendigkeit des raschen Handelns steht für Hunziker ausser Frage. «Früher hiess es: Wer nicht innoviert, wird renoviert. Heute heisst es: Wer nicht digitalisiert, wird liquidiert.» Studienautor Schmitt empfiehlt Unternehmen, solche Selbstchecks regelmässig zu wiederholen, Fortschritte zu diskutieren und einen strategischen Ansatz zu verfolgen, wie digitale Transformation als eine Haupttriebfeder für die Unternehmensexistenz kurz-, mittel und langfristig beiträgt.
Zusammenfassung der Masterarbeit (PDF)
Vollständige Masterarbeit (PDF)
Dieser Beitrag wurde von digital-liechtenstein.li verfasst
